 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Das Copyright für alle Texte und Bilder auf diesen Seiten liegt in vollem Umfang bei Andreas Lobe. Davon ausgenommen sind gekennzeichnete Zitate und verlinkte Bilder. Hier liegt das Copyright bei den Urhebern. Gleichzeitig erhebe ich Titelschutz für: PURPUR - Die in allen Schreibweisen. Mail-Adresse: |
|||||||||
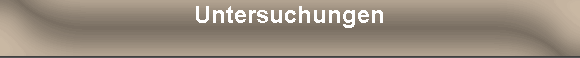 |
|||
|
Vorbemerkung Ich habe versucht, mich diesem schwierigen Thema so seriös wie möglich zu nähern. Deshalb habe ich auch darauf verzichtet, irgendwelche Versuche anzustellen, die darauf hinausgelaufen wären, so etwas wie ein Grabtuch nachzumachen. Ich war mir im Klaren darüber, dass diese Färber schon im dreizehnten Jahrhundert 2700 Jahre Vorsprung hatten bei der Entwicklung und Anwendung ihres Verfahrens und ich bin nicht arrogant genug zu glauben, dass ich, dazu noch als Einzelner, diesen Vorsprung in zwei Jahren aufholen könnte. Bei meinen Untersuchungen habe ich mich auf “Laborversuche” beschränkt und mit nur kleinen Mengen dieser Schneckensekrete auf Zellstoff und altem Leinen gearbeitet. Das hatte natürlich auch den Grund, dass grössere Quantitäten dieses Sekrets heute nur sehr schwer zu beschaffen sind. Zur Zeit setzt sich in der Forschung eine neue Einstellung durch, die das Mittelalter nicht mehr als “ finster und primitiv “ sehen möchte - die Leistungen dieser Zeit werden neu untersucht und bewertet und deshalb hat sich mein Umgang mit dieser Zeit auch an Ansätzen wie zum Beispiel dem von Prof. Dr. Reinhard Krüger orientiert.
Es ging im Wesentlichen um zwei Bildtypen; einmal die “Wahren Bilder”, monochrom aufgebaut aus Abstufungen eines warmen Rotbrauns und dann das Grabtuch, dessen Bildinformationen von „stroh-gelben Verfärbungen an der Faseroberfläche“ der Leinenfasern gebildet wurden. Ich wollte herausfinden, ob man mit den Mitteln der Purpurfärbung solche Veränderungen an Leinenfasern über einen Belichtungsvorgang hervorrufen kann. Die erste, naheliegende Frage war, wie dieses Färbeverfahren funktionierte und woraus dieses "Chromogen", diese Farbvorstufe des Purpurs chemisch gesehen besteht. Hier half das Internet weiter: Di-bromiertes Indol. Das war interessant. Damit wäre - chemisch betrachtet - eine angenommene, mittel- alterliche Purpurfotografie mindestens genauso dicht an der modernen Silberfotografie dran gewesen wie Daguerre mit seinem Verfahren. Und den betrachtete man schliesslich als den Erfinder der Fotografie. Indol war der Farbstoff der Indigofärbung. Di-bromiert bedeutete, dass an ein Indol- Molekül je zwei Bromatome angehängt waren. Entweder, weil sie freie Plätze besetzten, oder weil sie die Atome anderer Stoffe verdrängt hatten. In der Silberfotografie funktioniert das, vereinfacht dargestellt, so: Lichtempfindliches Silberbromid entsteht, wenn ein Silbersalz (Silbernitrat) mit einem Bromsalz zusammen gebracht wird. Anders als elementares, metallisches Silber hat das Silberbromid keine amorphe Struktur, sondern eine kristalline. Kristallgitter sind normalerweise sehr stabil - auf das Bromsilber trifft das aber so nicht zu. Und daran ist die "Bromierung" schuld: Die eingebauten Bromatome machen die Kristallgitter instabil. Sobald genug Energie in irgendeiner Form zugeführt wird, zum Beispiel durch Lichtquanten, zerfällt das Silberbromid in seine Bestandteile: Silber und Brom. Um diesen Vorgang einzuleiten, genügen auch schon geringe Energiemengen: Dann wird das Kistall instabil, zerfällt aber nicht sofort. Der Zerfallsvorgang der belichteten Silberbromide muss durch eine chemische Behandlung ausgelöst werden, die sogenannte Entwicklung. Den Vorgang der Energiezufuhr durch Licht, der diese Umwandlung ermöglicht, nennt man Belichtung. Alle modernen analogen fotografischen Verfahren funktionieren mit Silberbromid, das auch Bromsilber genannt wird. Davor war kurzzeitig auch mit anderen Silber-Halogen- Verbindungen experimentiert worden - aber ohne grossen Erfolg. Daguerre hatte mit jodiertem Silber gearbeitet. Silber war der Grundstoff und als Zusatz, der das Silber lichtempfindlich macht, hatte sich Brom am Besten bewährt. Eine angenommene Purpurfotografie würde also mit bromiertem Indol funktionieren. Dieses bromierte Indol ist aber kein chemisch hergestelltes Produkt wie Silberbromid, sondern kommt in lichtempfindlicher Form in der Natur vor. Stroh-gelbe Verfärbungen, wie von Verätzungen, hatte ich im STURB-Report gelesen. Etwas machte mich stutzig: Bei der Silberfotografie wurde Brom freigesetzt. Ich hatte nie etwas davon gelesen, was mit diesem Stoff passierte. Wahrscheinlich, weil Brom ein Halogen und leicht flüchtig ist. Brom geht schnell und bereitwillig Verbindungen mit anderen Stoffen ein. Brom ist sehr aggressiv, zersetzt Eisen, greift sogar Edelstahl an. Und in der Farbvorstufe des Purpur war eine ganze Menge Brom: je zwei Brom-Atome auf ein Indol-Molekül. Was aber jeder “Silberfotograf” weiss: Wenn man einen fotografischen Abzug nicht ausreichend wässert und dadurch chemische Abfallstoffe im Papierfilz zurückbleiben, dann bekommt das Bild Flecken. Strohgelbe Verfärbungen - wie von Verätzungen. An der Oberfläche der Fasern. Und dann stiess ich auf den Hinweis, dass keine dieser Verfärbungen unter den Blutspuren auf dem Tuch zu finden waren. Das war unglaublich. Ich wusste, was das bedeutete. Eigentlich war es das letzte Indiz, das mir noch gefehlt hatte. Aber davon mehr am Ende dieses Abschnitts.
"Privatissimum für Purpurfreunde". So wie der Titel vermuten liess, war es um den Inhalt bestellt. Viel Staub und Wind - wenig Gold. Und das dazu noch gut versteckt.
Ich dachte darüber nach, ob es eine gute Idee wäre, nach Kreta zu fahren - dort hatte es im Mittelalter offenbar grosse Vorkommen dieser Schnecken gegeben. Ich sah mich schon in den Felsen herumklettern und Schnecken suchen - aber hatte ich eine Wahl? Die ganzen Fehler und Ungenauigkeiten in dem, was ich bisher über die Purpurfärbung gefunden hatte, rührten genau daher: Dass offenbar fast niemand seit dem Mittelalter sich entsprechend mit diesen Tieren auseinandergesetzt hatte. Was Dedekind "Purpurforscher" nannte, waren nur selten ausgewiesene Biologen, eher Sprachforscher und/oder allgemein Gelehrte, von denen die meisten wohl nie eines dieser Tiere zu Gesicht bekommen hatten. Die suchten nicht die Schnecken, sondern nach Erwähnungen der Färbung in alten Dokumenten oder stritten um die Herkunft und Bedeutung des Wortes "Purpur". Und selbst bei dem einzigen Forscher, der laut Dedekind "sein Leben der Purpurforschung geweiht" hatte, waren die Ergebnisse eher oberflächlich, seltsam desinteressiert und nichtssagend. Vor allem dieser - für mich - fast unglaubliche Fakt, dass ein Tier (!) einen hoch lichtempfindlichen Stoff produziert, interessierte diese Leute scheinbar gar nicht besonders. Aber auch da gab es einige, wenige Ausnahmen. Besonders interessant war ein Bericht über die Wiederentdeckung der Schnecken: Ein schottischer Naturforscher namens William Cole hatte um 1684 herum davon gehört, dass norwegische Frauen an ihrer Wäsche "unvergängliche Zeichen" anbrachten und dazu den "Saft" einer Meerschnecke verwendeten. Dieser Saft sei weiss wie Milch und färbe sich erst an der Sonne in ein kräftiges Rot. Aus den Texten und Protokollen in Dedekinds Büchern, die von Menschen verfasst worden waren, die sich tatsächlich mit den Schnecken befassten, sie in die Hand genommen und den Farbumschlag beobachtet hatten, konnte man herauslesen, wie fasziniert sie von dem waren, was sie sahen. Das kannte ich von der Silberfotografie her. Es funktioniert eben, man legt den Film in die Kamera, drückte auf den Auslöser und am Ende hatte man ein Bild - wunderbar! Aber ein Wunder? Ein Wunder wurde es erst, wenn man diese Leute in eine Dunkelkammer mitnahm und ihnen das Verfahren an der offenen Schale vorführte. Dann kannte das Staunen kein Ende.
Zufällig war mein Kollege, der mich auch auf die Bücher von Dedekind hingewiesen hatte, gerade in Hamburg, um den Stadt-Marathon mitzulaufen. Ich hetzte ihn, noch in seinen Laufschuhen, über die diversen Fischmärkte der Stadt. Ergebnis nach drei Tagen: Niemand hatte dort je von diesen Schnecken gehört. Ein paar Tage danach flog ein anderer Kollege nach Istanbul: Auch dort waren Murice oder Murex unbekannt. Ich schickte noch einmal eine weitere Mail an die zwölf Fischgroßhändler, von denen kein Einziger auf meine erste Anfrage geantwortet hatte. Und diesmal kamen innerhalb von nur drei Tagen zwei Antworten. Der erste Händler sass in Stuttgart, vor meiner Haustür, wollte mir gerne alles Mögliche verkaufen - und hatte offenbar keine Ahnung, um was es eigentlich ging. Aber der Zweite, ein Österreicher, kannte sich aus. Ja, Murice, die habe er schon mal gesehen, in Venedig bei einem Händler, mit dem er zusammenarbeite. "Das sind Stachelschnecken, die, mit diesem turmartigen Gehäuse und dem langen Siphon, oder?"
Am nächsten Morgen nahm ich die erste aufgetaute Schnecke, schaltete die gelbe Dunkelkammer-Beleuchtung ein und versuchte, das Rezept des Biologieprofessors nachzukochen: Man zerschlägt das Schneckenhaus mit einem kleinen Hammer und stösst auf das, was man offenbar den "Organsack" nennt: Eine dünne, transparente Haut, in der die verschiedenen Organe untergebracht sind. Dieser Organsack lag in den Windungen des Hauses, auf einem kräftigen Muskel, der in einer hornartigen Platte endete. Die Unterseite dieser Platte hatte ich von aussen gesehen, als das Haus noch unversehrt war: Sie passte genau in die Öffnung des Hauses und verschloss es. Am anderen Endes des Organsackes war der Enddarm, gefüllt mit einer ziegelroten Masse - Exkrementen. Laut dem Rezept sollte man jetzt folgendermaßen vorgehen: Man entfernt den Darm und die Hornplatte und schneidet den Rest in kleine Stücke. Die kommen in einen Porzellan- Mörser und werden zusammen mit einem Teelöffel Meersalz und einem halben Teelöffel Flusssand zerrieben. Die entstandene Masse verdünnt man mit einer kleinen Menge Wasser und füllt sie in ein Filtertuch. Jetzt sollte man als Filterergebnis eine weisslich bis gelbliche Flüssigkeit erhalten, die dann auf Lichteinwirkung mit Rotfärbung reagiere. Ich tupfte das herausgepresste Fluid, das eher grau als weiss war, auf ein Stück Zellstoff und ging erwartungsfroh nach draussen, wo eine kräftige Maisonne schien. Nach einer halben Stunde war immer noch nichts passiert. Nach einer Stunde war der Fleck zwar getrocknet, aber immer noch keine Verfärbung zu sehen. Ich überprüfte das Rezept, konnte aber keinen Fehler feststellen. Ich fing noch mal ganz von vorne an, mit einer zweiten Schnecke und kam zum selben unbefriedigenden Ergebnis. Ich brach das Ganze ab. Da stimmte irgend etwas nicht - wahrscheinlich mit den Schnecken! Ich reinigte eines der Schneckenhäuser und ging damit in die Bibliothek. Das war ganz eindeutig eine Murex brandaris. Ich überlegte, ob es daran liegen konnte, dass die Schnecken den Farbstoff nur zu bestimmten Zeiten entwickelten, ob es am Geschlecht liegen konnte oder ob Degenerationserscheinungen schuld sein konnten. Genetische Veränderungen aufgrund der Verschmutzung des Mittelmeeres? Zum Schluss nahm ich mir noch einmal Plinius vor. Dessen Schilderung der Purpurgewinnung hatte ich recht schnell beiseite gelegt, als mir klar wurde, dass auch er nichts von der Lichtempfindlichkeit des Schnecken-Sekrets wusste. Aber Plinius schrieb, dass die Phönizier die grösseren Schnecken öffneten und ihnen eine "Ader" herausschnitten - und die sollte das Chromogen, die Farbvorstufe der Purpurs enthalten.
Diesmal tat sich etwas. Ein Fleck, der mit der Nummer drei, färbte sich innerhalb von etwa 5 Minuten hellrot! Das "Organ", von dem der Abdruck stammte, war eine gallertähnliche, farblose Masse gewesen - mit einem grünlichem Schimmer vielleicht. Ich öffnete die nächste Schnecke und isolierte den betreffenden Teil, machte einen neuen Abdruck und hatte wieder Glück! Wieder in der Dunkelkammer holte ich eine weitere Schnecke aus dem Kühlschrank - die letzte, die ich für diesen Tag aufgetaut hatte. Als ich sie öffnete und das Gallert-Organ isolierte, fand ich in ihm einen kräftig giftgrünen Streifen, fast "neonfarben", wie das Fruchtfleisch von einem Kiwi. Genau diese Farbe. Konnte das die "Ader" sein, von der Plinius schrieb? Ich isolierte den giftgrünen Stoff und strich ihn auf ein Stück Leinen. Dann entfernte ich den übrigen, gallertartigen Stoff und legte das Hautstück der "Ader" daneben. Das war es: die Haut der "Ader" war die Drüse, der giftgrüne Stoff ein Vorprodukt der weissen Milch, die von den lebenden Schnecken ausgeschieden wird. Das umgebende farblose Gelee war eventuell ein Vorprodukt des grünen Stoffes.
Durch meine Versuche mit dem Original-Material war es mir jetzt möglich, die Quellenlage ganz neu zu beurteilen. Die nach-mittelalterliche Geschichte der Purpurfärbung war grösstenteils von Leuten geschrieben worden, die weder das Material noch die Schnecken je zu Gesicht bekommen hatten. Plinius, da war ich mir jetzt fast sicher, hatte die Schnecken nie aus der Nähe gesehen. Sonst hätte er etwas über die auffällige Färbung der "Ader" geschrieben. Alles andere in diesem Organsack war transparent, schmutzig gelb oder braun - und darin leuchtete dieser grüne Streifen wie eine Neon-Reklame. Und der Biologe hatte, meiner Meinung nach, keinen Purpur extrahiert. Woher er das Rezept hatte, war mir ein Rätsel. Ich schrieb ihm eine Mail, die jedoch nie beantwortet wurde. Als ich einige Zeit später die Seite mit dem Rezept im Internet noch einmal aufrufen wollte, war sie verschwunden - gelöscht? Wenn, dann nur vorübergehend. Inzwischen gibt es sie wieder. Dann wurde in einem hohen Mass abgeschrieben: Ich fand ein Dokument über die Purpurfärbung, in dem die farbproduzierende Drüse im Hypobronchial-Kanal der Schnecken lokalisiert wurde. Das war fast richtig, leider aber falsch geschrieben, es musste Hypobranchial-Kanal heißen. Durch diesen Fehler konnte ich verfolgen, wer alles diese Quelle benutzt hatte - ohne sie zu nennen. Oder ein Dokument im Internet, ohne Jahresangabe, aber eindeutig aus unserer Zeit, von einem sogenannten "Chemikerforum" verfasst, das zur Purpurfärbung stolz einen Wissenstand präsentierte, der vor Cole, also vor 1684 eingeordnet werden musste.
Dieser Ton entsprach in einem hohen Mass dem, was ich auf den Mandylion- Darstellungen der mittelalterlichen Maler von Campin bis Bosch gesehen hatte. Und er entsprach einem Farbton, den ich aufgrund einer persönlichen Erfahrung mit etwas anderem verband: mit Ikonen. Und dann ging mir auf, dass die Acheiropoieta- Kopien, die ich bisher gesehen hatte, natürlich auch Einiges an sich hatten, was an Ikonen denken liess. Alleine schon deshalb, weil Ikonen Portraits von Jesus sein sollten - nicht nur, aber meistens. Und dann noch diese Farbe ... Was wusste eigentlich der Brockhaus über Ikonen zu sagen?
Die Vorbilder der Ikonen waren die Acheiropoieta! "Mandylion" war ja nur ein weiterer Name für das Edessa-Bild. Anders ausgedrückt: Die Ikonenmalerei war ursprünglich als Technik zur Vervielfältigung und Verbreitung der "Wahren Bilder" entwickelt worden. Die Kirche wollte sich wohl nicht ausschliesslich auf die wunderbare Kopierfähigkeit der Bilder verlassen. Das machte Sinn. Hier konnte ein weiteres Zwischenergebnis formuliert werden, das einige mediengeschichtliche Brisanz hatte: Und der Umgang mit diesen Bildern war einer Priesterkaste vorbehalten. Wie ein moderner Medienkonzern hatte die Kirche sich das Monopol der Herstellung und Verbreitung gesichert. CNN im Jahre 544 nach Christus.
Was die "Strohgelben Verfärbungen an der Faseroberfläche" des Grabtuches anging, aus denen das Bild auf dem Tuch bestand - da hatte ich ziemlich genaue Vorstellungen, wie die zustande gekommen waren: Das farblose Gelee in der Drüse, aus dem vermutlich die Farbvorstufe des Purpurs hergestellt wird, enthält Brom, aber kein Indol. Deshalb verfärbt es sich nicht, wenn es der Sonne ausgesetzt wird. Wenn man es aber auf ein feuchtes Stück Leinen schmiert, ins Sonnenlicht legt und dabei weiter feucht hält - dann kann man nach einiger Zeit gelbe Verfärbungen an der Faseroberfläche des Leinens beobachten. Wodurch werden die verursacht? Die Energiezufuhr durch die Lichtquanten löst den Brom aus seiner Verbindung heraus. Jetzt sucht er neue Stoffe, mit denen er eine Verbindung eingehen kann. Wenn Wasser vorhanden ist, löst er sich darin. Es entsteht sogenanntes Bromwasser. Dieses Brom- wasser spaltet sich unter einer bestimmten Vorraussetzung in Sauerstoff und Brom- wasserstoff auf. Und dieser Bromwasserstoff ist wiederum in Wasser leicht löslich. Es entsteht eine starke Säure - Bromwasserstoffsäure. Und die Voraussetzung, unter der Bromwasserstoff gebildet wird? Als ich diesen Hinweis im „Lexikon der Chemie“ fand, war ich mir schon sehr sicher, dass ich das Rätsel gelöst hatte. Ein gültiger Beweis wird aber unter kontrollierten Bedingungen in einem chemischen Labor erbracht werden müssen. Ich vermute übrigens auch, dass in dieser Reaktion der Grund zu suchen ist, weshalb sich der Purpur so stark an die Faser binden kann. Wenn die Farbvorstufe auf dem Leinen aufzieht und das Sonnenlicht den Brom herauslöst, dann bildet sich Bromwasser- stoffsäure. Diese ätzt die Faser an und dort kann sich der Purpurfarbstoff besonders haltbar anlagern. Das funktioniert bei Leinen vielleicht deshalb besonders gut, weil Leinen in der Faser bis zu 40 % seines Gewichtes an Wasser speichern kann, also das Wasser dort bereithält, wo es zu dieser Säurebildung gebraucht wird.
Ein grosses Problem für beide Fraktionen, der Befürworter der Echtheit des Tuches, wie auch für die Gegner, war die Tatsache, dass es unter den Blutflecken keine Bildspuren gab. Dafür musste es einen Grund geben. Erklärbar wurde das, wenn man davon ausging, dass es sich bei dem Bild auf dem Grabtuch um ein fotografisches Produkt handelte. Wenn echtes Blut mit einem einfachen, monochromen, also einfarbigen Verfahren fotografiert wird, stellt es sich im Positiv meistens sehr dunkel, fast schwarz dar. Ich hatte diese Erfahrung schon selbst gemacht: Auf dem Schwarz-Weiß-Abzug sah ein blutüberströmtes Gesicht aus, wie mit Schokoladensoße bekleckert. Das lag daran, dass selbst frisches Blut relativ wenig Licht reflektiert und dazu Schwarz-Weiß-Filme auf Rot weniger empfindlich reagieren, als auf andere Farben. Und wo kein Licht reflektiert wird, gibt es keine Belichtung auf dem Negativ. Nehmen wir einmal an, diese "strohgelben Verfärbungen an der Oberfläche der Fasern" aus denen sich laut dem STURP-Bericht das Bild auf dem Tuch zusammensetzt, seien über eine Belichtung zustande gekommen. Das dunkle, alte Blut auf dem Leichnam, den wir dann als Modell annehmen müssen, reflektierte kaum Licht. Und deshalb hinterliess das Blut auch keine oder fast keine Belichtungsspuren auf dem Negativ, also dem Grabtuch. Wenn wir weiter davon ausgehen, dass die Blutflecken auf dem Tuch später, sozusagen als "Finish" der Fälschung hinzugefügt wurden, und zwar genau da, wo auf dem Modell Blut gewesen war, dann wird klar, warum unter den Blutspuren keine Belichtungsspuren zu finden sind. Also ist das Fehlen solcher Bildspuren unter den Blutflecken ein weiteres starkes Indiz, das für ein Zustandekommen der Abbildung durch einen fotografischen Effekt spricht.
Übrigends kann dieser Effekt auch heute noch beobachtet werden: Bei schlecht gewässerten Silber-Gelatine-Fotos kann man ähnliche Spuren auf dem Schichtträger finden - gelbe Flecken, die manchmal sogar auf die fotografische Schicht durchschlagen.
|
|||
| [Startseite] [Purpur] [Hintergrundinfos] [Die Bilder] [Untersuchungen] [Historisches] [Rekonstruktion] [Aktuelles] [English] [Impressum] |
 |